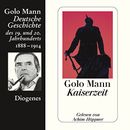
by Golo Mann
Der Diogenes Verlag hat das ungekürzte Buch “Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts” von Achim Höppner (die Synchronstimme Clint Eastwoods) einlesen lassen und es in acht Hörbücher aufgespalten, die jeweils einen wichtigen Abschnitt in der deutschen Geschichte repräsentieren.
…
Seit fünfundzwanzig Jahren war Bismarck der erste Staatsmann Europas gewesen, zeitweise sein Schiedsrichter. Seinen persönlichen Gaben nach gehörte er in die Reihe der großen Machthaber der Vorzeit, Wallenstein, Cromwell, Napoleon. Während aber jene in vergleichbaren Krisen vor dem Äußersten nicht zurückschreckten, vor Bürgerkriegen und Rebellion, konnte der preußische Minister nichts anderes tun, als artig sein Abschiedsgesuch verfassen in dem Augenblick, in dem ein junger, verdienstloser Mensch es von ihm forderte. Die Armee war königstreu – nicht ohne sein starkes Zutun. Der Reichstag war ohnmächtig – durch seine Schuld. Er war ihm übrigens spinnefeind. Hätte er die Parteiführer zu Hilfe gerufen, sie hätten die Achseln gezuckt oder ihn ausgelacht.
…
Das Deutschland der neunziger Jahre war auch das Deutschland Gerhart Hauptmanns, Richard Dehmels, Max Webers. Das politische Deutschland aber und das industrielle Deutschland, Deutschland als Machtgebilde, repräsentierte der junge Kaiser nur allzu gut. Das Kraftstrotzende, Expansive, Prahlerische, das von Gefahren nichts Wissende, über dünne Eisdecken Stapfende, als sei der Boden aus lauter Kruppstahl, eben jenes, wovon der amerikanische Beobachter meinte, es müsse früher oder später explodieren – dies Element wußte der Kaiser glänzend darzustellen.
…
Nun wäre es sehr falsch, sich das öffentliche Leben unter Wilhelm II. als eine dauernde Krise vorzustellen. Es lebte sich bequem unter des Kaisers persönlichem Regimente. Die wirtschaftliche Blüte kam, solange sie dauerte, den breiten Volksmassen wie den Reichen zugute. Bewundernswertes in der Förderung des Gesunden und Schönen leistete die Selbstverwaltung der Kommunen. Von weither kamen die Fremden, die in der geistreichen Arbeitswelt Berlins, in der behaglich freieren, gastlichen Atmosphäre Münchens oder Dresdens zu leben wünschten. Auf die Errungenschaften des liberalen Zeitalters war Verlaß. Mochte das Beamtentum rauhbeinig sein, es kannte seine Pflichten und die Rechte der Bürger.
…
Deutschland hatte sich unbeliebt und gefürchtet gemacht. Das war nicht an sich eine Folge seiner wirtschaftlichen Expansion. Im Gegenteil, die brachte es in engere Verbindung mit Rußland, mit England und vor allem mit Frankreich. Nie waren die Kontakte zwischen den deutschen und französischen Montanindustrien so eng wie in den letzten Jahren vor 1914. Optimistische Leute sahen darin eine Garantie für den Frieden. Eine Kriegsgefahr war es ganz bestimmt nicht. Diese kam von der Politik;
…
Einmal in das politische Spiel geraten, hatte Deutschland, die neueste, bald die stärkste europäische Macht, seine Nachbarn in Angst gejagt. Es hatte nichts getan, um die Bildung des Ringes um es herum zu verhindern, bevor er sich geschlossen hatte; überzeugt, daß es immer Herr der Situation bleiben und nicht zu wählen brauchte. Als der Ring geschlossen war – Frankreich, England, Rußland -, hatte es mehrfach versucht, ihn zu brechen, aber dadurch hatte es ihn nur fester gemacht. Es trumpfte auf, um zu beweisen, daß es da sei und stark sei und man nichts gegen seinen Willen tun könne. Daher die Reihenfolge der Krisen, welche Bethmann im düsteren Rückblick aufzählte. Regelmäßig ging es um nahezu belanglose Gegenstände, regelmäßig war das Recht durchaus nicht eindeutig auf der Seite der Gegner, regelmäßig gebrauchte Deutschland Methoden, die nach Bethmanns Ausdruck »das äußerste Risiko« mit einschlössen. Mit jedem Mal wurde das Risiko größer, nämlich der Krieg wahrscheinlicher. Denn »die anderen« würden sich dem deutschen Auftrumpfen nicht immer fügen, würden einmal glatt sich weigern, nachzugeben, dann würde Deutschland um seiner Ritterehre willen nicht zurückkönnen und dann würde Krieg sein. Hätten die anderen – Franzosen, Russen – moralisch auf einer höheren Stufe gestanden als die Deutschen, dann hätte es wohl Mittel gegeben, aus diesem verhexten Kreis herauszukommen. Aber sie standen nicht höher. Auch sie rechneten mit dem Krieg. Auch sie waren sicher, daß sie ihn gewinnen und nach großen Opfern große Vorteile aus ihm ziehen würden. Sie sahen es gern, daß Deutschland sich immer mehr vereinsamte und sich verrannte, sie halfen ihm nicht heraus. Nur waren sie klug genug, die Verantwortung für das, was früher oder später ja doch kommen würde, Deutschland zu überlassen.
…
Das Deutsche Reich war selber ein großer Nationalstaat und fürchtete im Grunde den Nationalismus der Balkanvölker nicht. Es hätte sich wohl mit ihm einrichten können. Die Österreicher fürchteten ihn und vor allem die Magyaren, das österreichische Herrschaftsvolk. Deutschland machte Österreichs antiserbische Politik mit, willig oder widerwillig; es hatte an sich kein Interesse daran. Wohl besaß es jetzt beträchtliche Interessen in der Türkei, wirtschaftliche sowohl wie politische. Hier stieß es direkt mit Rußland zusammen, das zwar wohl oder übel bereit war, Konstantinopel im Besitz der Türkei zu lassen, das aber keiner Großmacht erlauben wollte, sich dort festzusetzen. Die deutsche Tätigkeit in der Türkei provozierte Rußland direkt. Jeder provozierte jeden. Aber jeder brauchte auch irgendwie jeden. Der Sorge vor der deutschen Macht hatten es die Russen mit zu verdanken, daß England ihnen Nordpersien eingeräumt hatte und überall in Asien nicht mehr stark gegen sie auftrat. Entfiel die deutsche Drohung, so mußte auch das heikle und widernatürliche, beständig vom Zusammenbruch bedrohte russisch-englische Einverständnis entfallen. Der Sorge vor dem russischen Imperialismus wohl auch hatten es die Deutschen zu verdanken, wenn England sich mit ihrer Stellung in Kleinasien abfand: im Frühsommer 1914 wurde in London ein Abkommen skizziert, welches die Fortführung der deutschen »Bagdadbahn« bis nahezu an den Persischen Golf, bis Basra erlaubte.
…
In der letzten außenpolitischen Rede seiner langen, ruhmreichen Laufbahn hatte Bebel gesagt:
»Es kann auch kommen, wie es zwischen Japan und Rußland gekommen ist. Eines Tages kann die eine Seite sagen: Das kann nicht so weitergehen. Sie kann auch sagen: Halt, wenn wir länger warten, dann geht es uns schlecht, dann sind wir der Schwächere statt der Stärkere. Dann kommt die Katastrophe. Alsdann wird in Europa der große Generalmarsch geschlagen, auf den hin sechzehn bis achtzehn Millionen Männer, die Blüten der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwaffen, gegeneinander als Feinde ins Feld rücken. Aber nach meiner Überzeugung steht hinter dem großen Generalmarsch der große Kladderadatsch (Lachen) – ja, Sie haben schon manchmal darüber gelacht; aber er kommt, er ist nur vertagt (große Heiterkeit). Er kommt nicht durch uns, er kommt durch Sie selber… Sie treiben die Dinge auf die Spitze… Sie stehen heute auf dem Punkte, Ihre eigene Staats- und Gesellschaftsform zu untergraben… Was wird die Folge sein? Hinter diesem Krieg steht der Massenbankrott, steht das Massenelend, steht die Massenarbeitslosigkeit, die große Hungersnot (Widerspruch rechts). Das wollen Sie bestreiten?« (Zuruf von rechts: nach jedem Krieg wird es besser!)
Facts:
English title: The History Of Germany Since 1789
Original title: Kaiserzeit (1888 – 1914)
Published: 1958
