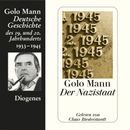
by Golo Mann
Der Diogenes Verlag hat das ungekürzte Buch “Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts” von Achim Höppner (die Synchronstimme Clint Eastwoods) einlesen lassen und es in acht Hörbücher aufgespalten, die jeweils einen wichtigen Abschnitt in der deutschen Geschichte repräsentieren.
Hier einige Zitate des achten Hörbuches “Der Nazistaat (1933 -1945):
Über das Nazireich ist viel geschrieben worden, deshalb habe ich mich für ein Exzerpt entschieden, das das Grundgesetz und seine Prinzipien kurz und prägnant beschreibt. Vor allem was aus der Geschichte gelernt wurde, und wie sich diese Lehren im Grundgesetz widerspiegeln.
…
Das »Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland«, in Wirklichkeit eine ausgewachsene Verfassung, reflektierte wenig von dem jakobinischen Geist Kurt Schumachers. Es war von den Erfahrungen der jüngsten Zeit bestimmt, von den weimarischen noch mehr als von den nationalsozialistischen, die staatsrechtlich allerdings wenig zu lehren hatten, eine demokratisch-föderalistische Verfassung, so wie die Alliierten befahlen, mit einer starken Dosis Pessimismus versetzt. Die politische Macht gehe vom Volke aus, hieß es und mußte es heißen. Schon der nächste Satz qualifizierte diese These; das Volk übe seine Macht aus durch Wahlen und durch die besonderen Organe der Legislative, der Exekutive und der Gerichtsbarkeit. Was bedeutete, daß es seine Macht nicht direkt ausüben sollte: keine Volksbegehren und Volksbefragungen mehr. Auch keine Volkswahl des Präsidenten; ihn sollte eine Nationalversammlung kreieren, die halb aus nationalen, halb aus Delegierten der Länder bestand. Der »Ersatzkaiser« der Weimarer Republik, Max Webers »charismatischer« Volksführer war damit verschwunden; ein freundlich-blasser »pou-voir neutre« trat an seine Stelle. Das Recht der Auflösung des Parlaments, das der alte Hindenburg so wacker wahrgenommen hatte, wurde dem Präsidenten genommen oder nur für den Fall zugestanden, daß das Parlament keinerlei regierungsfähige Mehrheit zu produzieren imstande wäre; auch dann, wie auch für jede Art von »Notverordnung«, sollte die Zustimmung der Länderregierungen notwendig sein. Diese waren in einem Bundesrat vertreten, eine Art von Oberhaus, wie in der Weimarer Zeit, und auch ein Teil der Exekutive, wie in der Bismarckzeit. Verfassungsänderungen, welche die Rechte der Länder beeinträchtigen, waren grundsätzlich verboten.
Die Einschränkung der Macht, die Ausschaltung des Volkes von jeder Direktaktion empfahl sich nach dem unter dem Nationalsozialismus gesammelten Erfahrungen; die Stabilisierung der Macht durch die Geschichte der Weimarer Republik. Ihr sollte eine der originellsten Erfindungen der Bonner gründenden Väter dienen, das »konstruktive Mißtrauensvotum«. Eine Regierung war nicht anders zu stürzen als dadurch, daß das Parlament einen neuen Regierungschef wählte. Die negative Koalition mußte unter Beweis stellen, daß sie zu positiver Arbeit fähig sei. Um eine zu große Vielfalt der Parteien zu verhindern, legte später ein Gesetz den Parteien auf, mindestens fünf Prozent aller abgegebenen Stimmen zu erringen; blieben sie darunter, so hatten die Wähler ihre Stimmen verloren. Beide Vorkehrungen, das konstruktive Mißtrauensvotum und die »Fünf-Prozent-Klausel« sollten ein disziplinloses, funktionsunfähiges Parlament verhindern.
Die Schwäche des Bundespräsidenten war die Stärke des Hauptes der Exekutive, des Bundeskanzlers. Er wurde vom Parlament gewählt, wobei der Bundespräsident das erste Vorschlagsrecht hatte; die übrigen Kabinettsmitglieder waren vom Staatsoberhaupt zu ernennen. Daß er der einzig gewählte Minister war, daß er, wie es im Wortlaut hieß, »die Richtlinien der Politik zu bestimmen hatte«, daß er nur durch eine Neuwahl gestürzt werden konnte, begründete die »Kanzler-Demokratie«, insofern sie konstitutionell begründet war. Die Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers tat den Rest, und vielleicht war dieser Rest die Hauptsache.
Die Bundesrepublik sollte ein föderaler, ein demokratischer, ein sozialer Staat sein. Ein paar Artikel sahen das Recht der Enteignung im Interesse des Gemeinwohles vor, von denen ein überaus bescheidener Gebrauch gemacht wurde. In einem anderen Sinn ist aber das neue Deutschland wirklich ein sozialer Staat geworden.
Imposant war die Liste der Grundrechte des Bürgers, die am Anfang des Dokuments zu stehen kam. Am Anfang; das sollte heißen, daß diese 19 Artikel über der Verfassung und über jeder positiven Gesetzgebung standen. Hier fehlte nichts, was die angelsächsische, die französische, die deutsche Philosophie in zweihundert Jahren erarbeitet hatte; nichts, was die blutigen Lehren der Hitlerzeit diktierten. Fünf Jahre früher waren »Volksschädlinge«, Abhörer fremder Radiostationen, »Defaitisten«, die am deutschen Siege zweifelten, zu Tausenden hingerichtet worden. Jetzt wurde die Todesstrafe abgeschafft. Fünf Jahre früher waren Kinder von vierzehn, Greise von sechzig in den Heeresdienst gepreßt worden; jetzt wurde das Recht zur Kriegsdienstverweigerung eigens stipuliert; das Recht, Menschen wegen ihres Glaubens, ihrer Rasse, ihrer Sprache zu verfolgen, eigens verneint. Und dann die Freiheiten, die garantiert wurden: des Glaubens, der Meinung, der Presse, der Rede, der Entfaltung der Talente. – Wie aber, wenn diese schönen Dinge mißbraucht wurden? Belehrt durch das Jahr 1932, nicht so unbedingt Rousseau-gläubig wie 1919, trafen die Konstitutionsmacher auch gegen diese Gefahr ihre Vorkehrungen. Wer seine Grundrechte mißbrauchte, um die freie demokratische Ordnung zu untergraben, der sollte sie verlieren. Politische Parteien, die sich gegen den Geist der Verfassung richteten, waren zu verbieten; nicht minder Assoziationen, die den Völkerfrieden gefährdeten. »Ich habe sie mit ihrem eigenen Wahnsinn geschlagen«, hatte Hitler 1933 geprahlt. Nun verschwor man sich, dergleichen nicht noch einmal zu erleben. – Es war die Selbstbeschränkung der Demokratie, welche ursprünglich die Sieger der Nation auferlegt hatten, und welche nun die neue deutsche Autonomie übernahm. Wir haben gegen ihre Logik nichts einzuwenden. Freilich wird die Frage: Wer garantiert für den Garanten? nie mit Sicherheit zu beantworten sein.
Die Verfassung, alles in allem, war gut, besser als die von Weimar, vorsichtiger, skeptischer. Sie hat sich auch besser bewährt, was ihr allein nicht zuzuschreiben ist.
…
Das »Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland«, in Wirklichkeit eine ausgewachsene Verfassung, reflektierte wenig von dem jakobinischen Geist Kurt Schumachers. Es war von den Erfahrungen der jüngsten Zeit bestimmt, von den weimarischen noch mehr als von den nationalsozialistischen, die staatsrechtlich allerdings wenig zu lehren hatten, eine demokratisch-föderalistische Verfassung, so wie die Alliierten befahlen, mit einer starken Dosis Pessimismus versetzt. Die politische Macht gehe vom Volke aus, hieß es und mußte es heißen. Schon der nächste Satz qualifizierte diese These; das Volk übe seine Macht aus durch Wahlen und durch die besonderen Organe der Legislative, der Exekutive und der Gerichtsbarkeit. Was bedeutete, daß es seine Macht nicht direkt ausüben sollte: keine Volksbegehren und Volksbefragungen mehr. Auch keine Volkswahl des Präsidenten; ihn sollte eine Nationalversammlung kreieren, die halb aus nationalen, halb aus Delegierten der Länder bestand. Der »Ersatzkaiser« der Weimarer Republik, Max Webers »charismatischer« Volksführer war damit verschwunden; ein freundlich-blasser »pou-voir neutre« trat an seine Stelle. Das Recht der Auflösung des Parlaments, das der alte Hindenburg so wacker wahrgenommen hatte, wurde dem Präsidenten genommen oder nur für den Fall zugestanden, daß das Parlament keinerlei regierungsfähige Mehrheit zu produzieren imstande wäre; auch dann, wie auch für jede Art von »Notverordnung«, sollte die Zustimmung der Länderregierungen notwendig sein. Diese waren in einem Bundesrat vertreten, eine Art von Oberhaus, wie in der Weimarer Zeit, und auch ein Teil der Exekutive, wie in der Bismarckzeit. Verfassungsänderungen, welche die Rechte der Länder beeinträchtigen, waren grundsätzlich verboten.
Die Einschränkung der Macht, die Ausschaltung des Volkes von jeder Direktaktion empfahl sich nach dem unter dem Nationalsozialismus gesammelten Erfahrungen; die Stabilisierung der Macht durch die Geschichte der Weimarer Republik. Ihr sollte eine der originellsten Erfindungen der Bonner gründenden Väter dienen, das »konstruktive Mißtrauensvotum«. Eine Regierung war nicht anders zu stürzen als dadurch, daß das Parlament einen neuen Regierungschef wählte. Die negative Koalition mußte unter Beweis stellen, daß sie zu positiver Arbeit fähig sei. Um eine zu große Vielfalt der Parteien zu verhindern, legte später ein Gesetz den Parteien auf, mindestens fünf Prozent aller abgegebenen Stimmen zu erringen; blieben sie darunter, so hatten die Wähler ihre Stimmen verloren. Beide Vorkehrungen, das konstruktive Mißtrauensvotum und die »Fünf-Prozent-Klausel« sollten ein disziplinloses, funktionsunfähiges Parlament verhindern.
Die Schwäche des Bundespräsidenten war die Stärke des Hauptes der Exekutive, des Bundeskanzlers. Er wurde vom Parlament gewählt, wobei der Bundespräsident das erste Vorschlagsrecht hatte; die übrigen Kabinettsmitglieder waren vom Staatsoberhaupt zu ernennen. Daß er der einzig gewählte Minister war, daß er, wie es im Wortlaut hieß, »die Richtlinien der Politik zu bestimmen hatte«, daß er nur durch eine Neuwahl gestürzt werden konnte, begründete die »Kanzler-Demokratie«, insofern sie konstitutionell begründet war. Die Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers tat den Rest, und vielleicht war dieser Rest die Hauptsache.
Die Bundesrepublik sollte ein föderaler, ein demokratischer, ein sozialer Staat sein. Ein paar Artikel sahen das Recht der Enteignung im Interesse des Gemeinwohles vor, von denen ein überaus bescheidener Gebrauch gemacht wurde. In einem anderen Sinn ist aber das neue Deutschland wirklich ein sozialer Staat geworden.
Imposant war die Liste der Grundrechte des Bürgers, die am Anfang des Dokuments zu stehen kam. Am Anfang; das sollte heißen, daß diese 19 Artikel über der Verfassung und über jeder positiven Gesetzgebung standen. Hier fehlte nichts, was die angelsächsische, die französische, die deutsche Philosophie in zweihundert Jahren erarbeitet hatte; nichts, was die blutigen Lehren der Hitlerzeit diktierten. Fünf Jahre früher waren »Volksschädlinge«, Abhörer fremder Radiostationen, »Defaitisten«, die am deutschen Siege zweifelten, zu Tausenden hingerichtet worden. Jetzt wurde die Todesstrafe abgeschafft. Fünf Jahre früher waren Kinder von vierzehn, Greise von sechzig in den Heeresdienst gepreßt worden; jetzt wurde das Recht zur Kriegsdienstverweigerung eigens stipuliert; das Recht, Menschen wegen ihres Glaubens, ihrer Rasse, ihrer Sprache zu verfolgen, eigens verneint. Und dann die Freiheiten, die garantiert wurden: des Glaubens, der Meinung, der Presse, der Rede, der Entfaltung der Talente. – Wie aber, wenn diese schönen Dinge mißbraucht wurden? Belehrt durch das Jahr 1932, nicht so unbedingt Rousseau-gläubig wie 1919, trafen die Konstitutionsmacher auch gegen diese Gefahr ihre Vorkehrungen. Wer seine Grundrechte mißbrauchte, um die freie demokratische Ordnung zu untergraben, der sollte sie verlieren. Politische Parteien, die sich gegen den Geist der Verfassung richteten, waren zu verbieten; nicht minder Assoziationen, die den Völkerfrieden gefährdeten. »Ich habe sie mit ihrem eigenen Wahnsinn geschlagen«, hatte Hitler 1933 geprahlt. Nun verschwor man sich, dergleichen nicht noch einmal zu erleben. – Es war die Selbstbeschränkung der Demokratie, welche ursprünglich die Sieger der Nation auferlegt hatten, und welche nun die neue deutsche Autonomie übernahm. Wir haben gegen ihre Logik nichts einzuwenden. Freilich wird die Frage: Wer garantiert für den Garanten? nie mit Sicherheit zu beantworten sein.
Die Verfassung, alles in allem, war gut, besser als die von Weimar, vorsichtiger, skeptischer. Sie hat sich auch besser bewährt, was ihr allein nicht zuzuschreiben ist.
Facts:
English title: The History Of Germany Since 1789
Original title: Der Nazistaat (1933 -1945)
Published: 1958
