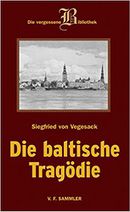
by Siegfried von Vegesack
Teil 3 der Baltischen Tragödie
Rezension kopiert von: Lettische Presseschau:
Der Krieg als bizarrer adeliger Gesellschaftstanz, nach ritterlichen Regeln geplant und mit wechselnden Partnern. Die Zahl der möglichen Verbündeten und Feinde erhöht sich nochmals auf dem kleinen speziellen Territorium an der Ostsee. Nun kommen Reichsdeutsche und Briten hinzu, Letten, die mit Esten, Deutschbalten oder den Bolschewisten sympathisieren. Russen spalten sich in Weiß- und Rotgardisten. Die Bündnisse bleiben fragil, dass Misstrauen ist groß. Die baltische Region ist eine blutige Staubmaus in einer Ecke Europas, wo die Schlachten noch ein Jahr nach dem Waffenstillstand von Compiegne weiter wüten. Das Ignorieren und die Abneigung gegenüber dem Fremd- und Andersartigen hat sich in Hass verwandelt. Roter Terror beherrscht Riga, Aurel entkommt nur knapp seiner Hinrichtung. Ritterliche Tugenden zählen nicht mehr. Lenins Gefolge erfindet den Schrecken totalitärer Gewalt, die ständig präsent ist und den Schlaf raubt:
„Man liegt, man kann nicht schlafen, man wartet. Etwas Unsichtbares, Furchtbares, Lähmendes lastet in der Luft, raubt einem fast den Atem. Nicht die Rotgardisten sind es, diese halbwüchsigen Burschen mit den Flinten unterm Arm, die nach dem Abzug der regulären Truppen durch die Straßen patroullieren – auch diese rohen Gesellen haben noch menschliche Züge. Aber hinter ihnen spürt man eine unsichtbare, unpersönliche, unmenschliche, dämonische Macht: das Böse schlechthin, den Satan. Nie hat Aurel an einen Teufel geglaubt. Aber in diesen schlaflosen Nächten fühlt er fast körperlich die Gegenwart einer unheimlichen Macht, die ihren dunklen Schatten über das Land geworfen hat und die sich mit jedem Tag unaufhaltsam immer weiter nach allen Seiten ausbreitet.“ (S. 514)
Die Gewalt bleibt nicht nur poetische Verheißung. Schon der Erste Weltkrieg kennt willkürliche Gefangennahmen und die Exekution vor Massengräbern. Auch die deutschbaltische Landeswehr, reichsdeutsche Divisionen und russische Weißgardisten sind nicht ohne: Das wilhelminische Motto: „Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht!“ wird auch von ihnen befolgt. Der deutschbaltischen Landeswehr bleiben nur reichsdeutsche Truppen als Verbündete. Hierzulande sind sie die Befremdlichen und Unzuverlässigen, die an Schnapsbuden saufen und zu Rätesoldaten mutieren.
Aurel hält sich an den überlieferten Tugenden. Seine Augenverletzung hindert ihn daran, in der Armee des Zaren zu kämpfen. Der Wunsch, Held zu werden, die Ahnung, eine „Nebenfigur“ zu bleiben, macht sein beschauliches Leben hinter der Front unerträglich. Der Erzähler gibt im inneren Monolog Gedanken Aurels wider, die sich in der Perspektive deutschbaltischen Selbstmitleids gestaltet:
„Welch ein Held! Jagst hier Hasen, während andere ihr Leben opfern. Vertreibst mit Kindereien die Zeit, faulenzt, läßt es dir gut gehen. Bist wieder ganz in dein träges baltisches Fell hineingekrochen. Aber was, zum Teufel, soll ich denn tun? versuchte er sich zu rechtfertigen: von diesem Krieg, von allem, was da draußen geschieht, bin ich ausgeschlossen. Uns Balten bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die Hände zu falten und die Daumen umeinander zu drehen. Abwarten, ausharren – immer dies langweilige `Ausharren`, auf das wir so furchtbar stolz sind. Siebenhundert Jahre haben wir nun glücklich `ausgeharrt` – auf dem `äußersten Posten deutscher Kultur im Osten` – wie es so schön heißt, sind von den Polen, den Schweden, den Russen, den Litauern, Letten und Esten abwechselnd gepiesackt worden – aber wir sitzen da und harren aus – eine großartige Beschäftigung. Und wenn die Welt einmal untergehen sollte, wir Balten werden sicher die Letzten sein: wir werden einfach ausharren! Also bitte sehr: was soll ich tun?“ (S. 420f.)
Diese Gedanken erweisen sich als lautes Selbstgespräch, denn Aurel bekommt von Freund Mischka, der mithörte, eine recht bürgerliche Antwort:
„Arbeiten!“ (S. 421)
Das reicht nicht hin. Die Hauptfigur, die vom Erzähler „kleine Nebenfigur“ genannt wird, will kämpfen, bricht die unnütze Vasallentreue zum Zaren. Ein Rückgriff auf die Familiengeschichte berechtigt zum Seitenwechsel: Auch sein Ahn, der Freiherr von Campenhausen, war einst aus ehrbaren Gründen Überläufer geworden. Dies gibt dem Nachgeborenen das Recht, nun für die deutschbaltische Landeswehr das letzte Aufgebot zu stellen. Die Hauptfigur des Romans lernt als Nebenfigur des Krieges nichts hinzu. Die alten Fantasien von Ritter- und Heldentum bestimmen weiterhin das deutschbaltische Denken. Dabei hat dieser Krieg längst allen Frontsoldaten das Los der Nebenfiguren zugewiesen. Sie sind Bauernopfer der Kriegsmaschinen, der Maschinengewehre, Kanonen und Tanks. Nicht die Tapferkeit des Einzelnen bedingt Sieg und Niederlage, Leben und Tod, sondern Waffengewalt und Zufall. Doch die baltendeutsche Perspektive reicht nicht hin, diese moderne Absurdität zu erfassen. Die Sprache bleibt heroisch bis zum bitteren Ende. Eines hat der züchtige Deutschbalte mit dem züchtigen Volksdeutschen gemeinsam – das Zusterbenverstehen:
„Der Weltkrieg ist ausgekämpft, aber dieser Krieg um das baltische Schicksal hat noch kein Ende gefunden, ja er fängt jetzt erst eigentlich an. Die Hauptakteure des großen Welttheaters haben ihr Stück zu Ende gespielt, sie treten zur Seite. Kleine baltische Nebenfigur, endlich kommst du an die Reihe. Und selbst wenn du jetzt für immer von der Bühne verschwinden solltest – es kommt auch auf den Abgang an, ob man zu sterben versteht. Deine Vorfahren konnten es, und gerade deshalb blieb ihr Blut hier leben. Nun hast du ihr Erbe anzutreten und nachzuweisen, daß du ihrer würdig bist. Ein hoffnungsloser, ein verzweifelter Kampf – aber kämpfte man hier nicht immer ohne Hoffnung, und kämpfte trotzdem? Ein winziges versprengtes Häuflein Deutscher, verlassen vom Mutterland, allein, ohne jeden Beistand, gegen tausendfache Übermacht – und trotzdem! Eine hoffnungslose, eine verlorene Sache – aber immer noch besser, ohne Hoffnung zu kämpfen, als kampflos unterzugehen. Na, nur keine großen Worte, nur nicht pathetisch werden! Nicht aus der Rolle fallen, kleine Nebenfigur: du hast ganz einfach deine Pflicht zu tun, und darüber verliert man nicht viele Worte…“ (S. 507)
Der Gedanke an Zucht und Selbstbeherrschung lässt das Pathos stocken, als wären die Worte nicht schon „groß“ genug gewesen. Tatsächlich werden die Deutschbalten diesen letzten Kampf verlieren, nicht heroisch gegen die Bolschewisten, sondern gedemütigt durch die eigenen Untertanen, Esten und Letten. Doch das gefährliche, ungleichzeitige Pathos, überliefert aus der Ritterzeit, übersteht das Kriegsende. Es wird die Kriegsrealität mythologisieren. Nur ein feiger Dolchstoß in den Rücken könne den deutschen Soldaten besiegt haben, so lügen die gefeierten Kriegshelden, die Generäle Ludendorff und Hindenburg. Die Freikorps, die in der baltischen Region ihr Handwerk verrichteten, werden mit dieser Mentalität in Berlin den Terror entfachen. Das Zusterbenverstehen wird Goebbels Propaganda übernehmen. Das unbelehrbare „Trotzdem“ wird nach den „letzten Tagen der Menschheit“, wie Karl Kraus die Zeit des Ersten Weltkriegs nannte, dieser Menschheit noch allerletzte Tage bescheren.
Facts:
English title: n/a
Original title: Totentanz in Livland
Published: 1935
